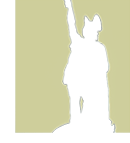Sie sind gerade im Bereich Home - Presse - Varus, Varus, wo sind deine Legionäre gestorben?
Varus, Varus, wo sind deine Legionäre gestorben?
Ein 2000-Jahr-Jubiläum rückt näher: 9 nach Christi Geburt besiegte der Cherusker Arminius die römischen Besatzer: Die Landesmuseen planen eine Großausstellung. Und Hobbyforscher suchen noch immer fieberhaft nach einem Schlachtfeld im Teutoburger Wald.
Von Andreas Fasel
Wenn es um die Varusschlacht geht, ist Johann-Sebastian Kühlborn kurz angebunden. „Ich kann's nicht mehr hören", sagt er hörbar genervt. Kühlborn ist Leiter des provinzialrömischen Fachreferates des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe und somit auch zuständig für Varus. Doch die wissenschaftliche Vernunft hatte bei diesem Thema schon immer einen schweren Stand gegen lokalpatriotische Gefühle, Unsachlichkeit und mitunter wahnhaften Eifer. Und deswegen habe er, Johann-Sebastian Kühlborn, bereits bei seinem Amtsantritt im Jahre 1978 erleichtert zu sich selbst gesagt: „Gott sei Dank, daß du im Jahr 2009 schon pensioniert bist."
Allerdings dringen die Vorbeben des Jubiläumsereignisses „2000 Jahre Varusschlacht" auch bis zu Kühlborn vor. Oder, um eine Formulierung des Lippe-Forschers Wilhelm Hansen zu verwenden: Die „Fieberkurve der Arminiusbegeisterung" schlägt derzeit wieder heftig aus.
Da sind zum einen die Pläne der offiziellen Stellen: In wenigen Wochen wollen die Museen Kalkriese; Haltern und Detmold ihr gemeinsames 2009-Großprojekt der Öffentlichkeit vorstellen: Die drei Institutionen bereiten eine Ausstellung vor, die sich über mehrere Standorte erstrecken und internationale Beachtung finden soll.
Aber das ist längst nicht alles. Der Sieg des Cheruskers Arminius über die Legionen des römischen Statthalters Publius Quinctilius Varus fasziniert noch immer ganze Heerscharen von Laien und Privatforschern. Immerhin läutete dieses Ereignis das Ende einer römischen Provinz Germanien ein. Angeheizt wird die Hysterie um die Schlacht dadurch, daß nach wie vor nicht bewiesen ist, wo das Massaker an mehreren zehntausend römischen Legionären stattfand. In Internetforen werden verschiedenste Theorien diskutiert.
Kürzlich veröffentlichte ein pensionierter Oberstudienrat ein 272 Seiten dickes Buch über die „Römer an Lippe und Weser'` (S. NRW 5: „Rolf Bökemeier... "). Ein Architekt aus dem Ruhrgebiet hat seine Mutmaßungen über die Positionierung der Römerlager auf große Stellwände geheftet. Und die plazierte er frech im Garten des Landesmuseums Detmold. Ein anderer Varusforscher grub vor wenigen Wochen mit dem Bagger nach einem Grabhügel der Römer - eine Aktion, die der zuständige Bodenkmalpfleger zwar genehmigte, aber lieber geheim gehalten hätte (Seite NRW 5: „Gerhard Tiggelkamp...").
Zu solchen immerhin um Wissenschaftlichkeit bemühten Unternehmungen kommen noch kuriosere Versuche, Licht ins Dunkel der Geschichte zu bringen: Ein westfälischer Wünschelrutengänger verschickt Kartenmaterial, in dem er sämtliche Lokalitäten vom Geburtsort des Arminius bis zum Sterbeplatz des Varus eingetragen hat. Und Rainer Friebe aus SachsenAnhalt glaubt unbeirrbar an einen Übersetzungsfehler - und vertreibt in Buchform die krude These, die Varusschlacht sei im Harz geschlagen worden.
Es gibt außer dem bevorstehenden Jubiläum noch einen weiteren Grund, warum es unter Varus-Forschern und -Begeisterten zugeht wie in einem aufgescheuchten Bienenstock. Ende der 90er Jahre wurde in Niedersachsen, am Nordrand des Wiehengebirges, das Museum Kalkriese eröffnet. Und dort wird plakativ und werbewirksam die These verbreitet, Kalkriese bei Osnabrück sei definitiv der Schauplatz der Varusschlacht - punktum!
Tatsächlich hat dort ein britischer Hobby-Forscher im Jahr 1987 mit seiner Metallsonde römische Münzen gefunden, die den Archäologen eine Spur zu einem großen Schlachtfeld wiesen. Unzweifelhaft ist also, daß in Kalkriese vor rund 2000 Jahren Römer gegen Germanen kämpften. Doch die Schlußfolgerung, daß dieser Kampfplatz der Ort der Varusschlacht sei, wird inzwischen von namhaften Münz-Spezialisten in Zweifel gezogen.
Sie vermuten, daß in Kalkriese ein anderes Gefecht stattfand: nämlich das gegen die Legionen des Feldherrn Caecina im Jahr 15 nach Christus, das ebenfalls in der römischen Literatur beschrieben ist. „Wir werden alles tun, damit bis zum Festakt 2009 die Varus-These der Kalkrieser widerlegt sein wird", sagt Peter Kehne, Historiker der Universität Hannover und einer der schärfsten Kalkriese-Kritiker.
Wo aber war die zum deutschen Nationalmythos verklärte Varusschlacht? Der westfälische Römerfachmann Johann-Sebastian Kühlborn will sich mit dieser Frage gar nicht erst abgeben - siehe oben.„Ich beschäftige mich nicht mit Spekulationen", sagt Kühlborn, „sondern nur mit den Realien aus dem Boden."
Und damit hat Kühlborn genug zu tun. Zum Beispiel müssen die Funde aus den Römerlagern Oberaden und Anreppen (Kreis Paderborn) ausgewertet werden. Immerhin hielt sich in Anreppen mit großer Wahrscheinlichkeit Tiberius auf, Stiefsohn des Kaisers Augustus und die damalige Nummer zwei des Römischen Reiches. Kühlborn erhofft sich nun Aufschluß darüber, wie die Anfänge einer römischen Provinzialisierung aussahen. Stützpunkte wurden angelegt, Märkte und kleine Städte entstanden. Und weil die Römer diesen Prozeß in Germanien bereits nach 30 Jahren wieder abbrachen; weil deshalb keine gemauerten Villen die hölzernen Lager überdecken, ist diese Phase nirgendwo sonst so gut zu rekonstruieren wie hier. Warum also nach der Varusschlacht suchen?
Auch die westfälisch-lippischen Bodendenkmalpfleger Daniel Bérenger, Elke Treude und Michael Zelle antworten auf die Frage nach dem Schlachtort mit einem Schulterzucken. „Die Frage bringt der Wissenschaft nichts mehr”, sagen sie. „Seit gut hundert Jahren gibt es in Westfalen die Römerforschung", erklärt Bérenger. „Aber von den Germanen wissen wir immer noch so gut wie nichts, null." Deswegen wird Michael Zelle nun Tausende Kisten mit germanischen Keramikfunden aus den Magazinen nach Detmold bringen lassen Unzählige Doktorarbeiten seien zu vergeben, sagt Zelle: „Wir müssen endlich auch den römischen Gegner erforschen."
Eines ist schon jetzt sicher: Die Vorstellung, daß die Römer sich bei ihrem etwa 30 Jahre währenden Ausflug nach Germanien in ihren Lagern verschanzten, um ab und zu hinauszumarschieren und eine Schlacht gegen wilde Barbaren zu schlagen, ist völlig verkehrt. „Die Beziehungen untereinander müssen vielfältig gewesen sein", sagt Zelle. Als Indiz dafür nennt er ein Blei-Bergwerk in der Nähe von Brilon, das vermutlich von den Römern benutzt wurde. „So eine Anlage kann man nicht betreiben, wenn man sich in ständiger Angst vor Angriffen irgendwo einigelt", sagt Zelle.
Es gibt also gute Gründe, daß die behördlichen Bodendenkmalpfleger zurückhaltend bis allergisch reagieren, wenn sie von den Hobbyforschern der Region immerzu auf das Problem Varusschlacht angesprochen werden. Doch Iris Schäferjohann-Bursian vermutet noch andere Zusammenhänge. Die freie Historikerin, die in Bad Lippspringe geboren ist, lernte durch Zufall den Varus-Amateurforscher Rolf Bökemeier kennen - und fing an, sich zu wundern, warum dessen akribische Arbeit von den Archäologen schlichtweg ignoriert wird. „Und wenn man ihm die Erlaubnis zu graben gab", sagt sie, „wurde alles unternommen, ihn zu blamieren.”
Auch glaubt Schäferjohann-Bursian, daß ältere Hinweise auf römische Funde und Varusschlacht nicht konsequent verfolgt worden seien. Sie mutmaßt, die nationalistische Vereinnahmung des Hermann-Mythos habe nach dem Krieg zu einer Gegenreaktion geführt: Die Suche nach den Resten dieses sagenumwobenen Gefechts sei quasi zum Tabu erklärt worden.
In einem Aufsatz für die Zeitschrift des „Lippischen Heimatbundes" fragte Iris Schäferjohann-Bursian deswegen: „Was ist los in Lippe?" Wie könne es sein, daß in Kalkriese mit einer wackligen Hypothese ein derartiger Wirbel um die Varusschlacht veranstaltet werde? Und daß in Lippe offiziell so getan werde, als sei dieses Ereignis, das die europäische Geschichte maßgeblich geprägt hat, nicht weiter von Bedeutung. Die Antworten auf diesen Artikel kamen prompt - und heftig. Der aggressive Ton dieser Schreiben zeige nur, daß sie ins Schwarze getroffen, sagt sie.
Mittlerweile ist Iris Schäferjohann-Bursian Geschäftsführerin des neu gegründeten Vereins Arminiusforschung e.V. Dessen Aufgabe besteht darin, Spenden für Forschung einzutreiben, illegal ausgegrabene Funde wieder aufzutreiben und zwischen den hitzköpfigen Protagonisten zu vermitteln. „Unter den Varusforschern gibt es viele Naturwissenschaftler oder Ingenieure. Deren Begabung kann doch der Archäologie nur nützen", sagt Schäferjohann-Bursian. Und anders als viele Archäologen, die gern im Stillen arbeiten, möchte sie „das Thema in den Medien in Konjunktur halten". Warum, fragt sie, gibt es eigentlich noch keinen tollen Film darüber?
(Welt am Sonntag, Nr. 27, 3. Juli 2005, S. NRW 4)
(C) Freundeskreis "Römerforschung im Weserbergland"!
Dieser Ausdruck wurde von der Internetseite http://www.roemerfreunde-weser.info gemacht.